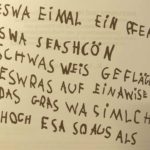Sensation? Rolle rückwärts beim Legasthenie-Konzept
Zunächst hielt ich es für eine klammheimliche Sensation: Der Grundschulverband gibt offiziell das störungsorientierte Legasthenie-Konzept auf! Die neue Auffassung heißt:
„Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten sind ein didaktisches, kein medizinisches Problem“.
Im ersten Staunen mutmaßte ich gar, das wäre eine der wenigen Gelegenheiten, das Wort „Paradigmenwechsel“ angemessen zu verwenden. Schließlich hat der Verband der Sache nach Recht: Es gibt nach wie vor keine guten Gründe, Legasthenie als Krankheit zu betrachten. Nach vorangehenden kritischen Erörterungen des Themas hier und hier folgte die genannte Stellungnahme des Grundschulverbands relativ still und leise im aktuellen Band 140 der Reihe „Beiträge zur Reform der Grundschule“ auf S. 212-214. Dort heißt es:
„Es gibt zu viele Menschen, die nicht gut genug lesen und schreiben können… Problematisch ist aber der Begriff der „Störung“. Mit ihm unterstellt die Leitlinie qualitative Besonderheiten bei Kindern und Jugendlichen im unteren Leistungsbereich, obwohl die Leistungen ein Kontinuum darstellen und sich nur graduell unterscheiden… Es ist deshalb Aufgabe von Elternhaus und Schule, Kindern die bestmöglichen Lernbedingungen zu schaffen. … Aus grundschulpädagogischer Sicht fordern wir (…) dialogische Formen der Lernbeobachtungen, in denen Testergebnisse eine dienende und keine dominante Funktion haben. Auch angesichts von Unterschieden, die schon am Schulanfang drei Jahre betragen, sind punktuelle, an Gruppennormen orienterte „Status-Diagnosen“ nicht hilfreich. Die individuellen Entwicklungen und Schwierigkeiten sind über lernbegleitende Beobachtungen zu erfassen …. [es] wird vor allem die hohe Bedeutung der individuellen Lehrerkompetenz für die kind- und problemgerechte Nutzung von Methoden verkannt. Diese erfordert eine Erweiterung des didaktisch-methodischen Repertoires der Lehrpersonen. … Die Lese- und Schreibdidaktik muss aber auch in der Aus- und Fortbildung von Lehrer/inne/n mehr Gewicht bekommen.“
(ebd.; Hervorhebungen von mir)
Wie überaus erfreulich, dachte ich. Doch dann kam Erwin Breitenbach und zügelte mit der Weisheit jahrzehntelanger schlechter Erfahrungen meinen anfänglichen Enthusiasmus ob dieser „Sensation“ – und er hat Recht. Sein berechtigter Unkenruf lautet: Wenn man sich anschaut, was die Didaktiker und Pädagogen (aka Lehrkräfte) in den letzten Jahrzehnten angesichts dieses „didaktischen Problems“ geleistet haben, sollte man nicht allzuviel Hoffnung schöpfen. Womit wir wieder auf dem unbequemen Boden der alltäglichen schulischen Tatsachen gelandet wären:
Bei aller Kritik an der Medikalisierung – in den Schulen ist jahrzehntelang nichts Konstruktives mit den schwachen Lesern und Rechtschreibern passiert. Ihre einzige Versorgung war die mit schlechten Noten. Die Pädagogen haben sich allzuleicht das Heft aus der Hand nehmen lassen und ihre Möglichkeiten, pädagogisch einzugreifen, nicht genutzt. Stattdessen waren sie damit beschäftigt, sensualistische Irrwege zu beschreiten oder sich selbst abzuschaffen, um dem Verdacht der Defizitorientierung zu entgehen. Einsicht in den didaktogenen Charakter von Lese-Rechtschreib-Problemen besteht in weiten Teilen der Lehrerschaft bis heute nicht.
Erst die Mediziner haben sich der Not der Kinder und Familien angenommen und versucht, diese mit ihren Mitteln zu lindern. Dabei kam – logischerweise – die Krankheit Legasthenie heraus, versehen mit Nachteilsausgleich. Letzteren hätten die Pädagogen schon vorher als entlastende Maßnahme bei schweren Fällen einsetzen können, die Schulgesetze boten dafür Spielraum genug – aber man war untätig geblieben. Ein Nebeneffekt der Legasthenie-Diagnose war die kostenlose zusätzliche Therapie, ein entsprechendes Attest (und damit eine entsprechende Kategorisierung) vorausgesetzt.
Und jetzt soll sich das alles ändern? Zur Genüge durften wir in den letzten Jahrzehnten Lippenbekenntnisse und schlaue Artikel der Pädagogen zum Thema Legasthenie verfolgen (es gibt sie, es gibt sie nicht, es gibt sie. ….), die ganze Zeit über begleitet vom schändlichen Versagen der Schule. Vielleicht könnte man nun hoffen: Nach der Abkehr vom Konzept „Legasthenie als Störung“ können die engagierten Pädagogen in Ruhe ihre Fehleranalysen vornehmen und individuelle Förderung in den Schulalltag integrieren. Aber bei längerem Nachdenken fürchte ich: Diese Hoffnung ist naiv. Die Pädagogen, die nur darauf brennen, Fehler zu analysieren und ihren Unterricht zu überarbeiten, sind in der Minderheit. Sie bewirken keine flächendeckende Änderung. Und selbst die engagierten Einzelkämpfer bringen fachlich in aller Regel nicht die nötigen Voraussetzungen mit, um schwierigen Fällen gerecht zu werden. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der Grundschulverband über die vage Andeutung hinaus, man hätte schon immer informative Handreichungen beim Verband erwerben können, wenig leisten wird. Der Mund ist voll und die Taschen leer – gerade in der aktuellen Lage, in der Geld für diverse Fördermaßnahmen knapp ist und an anderen Ecken gebraucht wird.
Wenn man zum jetzigen Zeitpunkt Ernst machte und den Legasthenie-Erlass zurücknähme, wären wir wieder in der gleichen Situation wie vorher: Die Kinder säßen im Unterricht bei den selben Lehrern, die jetzt „Diagnosen“ (oder was sie dafür halten) wie Gummibärchen verteilen. Dann aber ohne die Möglichkeit, diese Mängel außerschulisch durch zusätzliche Therapie oder Nachhilfe auszugleichen (bzw. bliebe dieser Weg nur wieder diejenigen, deren Eltern das nötige Kleingeld dazu haben). Wer die Klassenzimmer zwischen Husum und Garmisch von innen kennt, dem fährt bei dieser Vorstellung der Schreck in die Glieder.
Also doch keine Sensation. „Nicht gegen den Fehler, sondern für das Fehlende“ ist mein liebstes Zitat von Paul Moor. Solange aber für das Fehlende in der Lehreraus- und Fortbildung nichts Wesentliches getan wird, ist das Bekenntnis gegen das Störungskonzept der Legasthenie in der Praxis vielleicht sogar schädlicher als die Beibehaltung der aktuellen Situation. Wie traurig ist das denn?